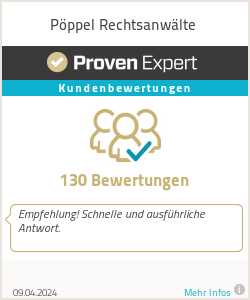Die Arbeitswelt verändert sich rasant – und mit ihr auch die Regelungen rund um Krankheit und Arbeitsfähigkeit. Der Vorschlag, eine gesetzliche Möglichkeit zur Teilkrankschreibung zu schaffen, sorgt für hitzige Diskussionen. Während Befürworter in ihr eine Chance zur besseren Integration von erkrankten Arbeitnehmern sehen, warnen Kritiker vor einer potenziellen Ausnutzung und zusätzlichen Belastung für Beschäftigte. Doch was würde eine solche Regelung konkret bedeuten? Dieser Artikel beleuchtet die arbeitsrechtlichen Hintergründe, mögliche Vorteile und Risiken sowie die Auswirkungen auf Arbeitnehmer und Arbeitgeber.
Arbeitsrechtliche Grundlagen
Derzeit gibt es in Deutschland nur eine vollständige Krankschreibung – entweder ist eine Person arbeitsunfähig oder nicht. Eine Ausnahme bildet das sogenannte Hamburger Modell, bei dem Arbeitnehmer nach längerer Krankheit schrittweise an den Arbeitsplatz zurückkehren können. Der Vorschlag für eine Teilkrankschreibung würde bedeuten, dass Beschäftigte trotz gesundheitlicher Einschränkungen teilweise arbeitsfähig sind und entsprechend anteilig arbeiten könnten.
Das Sozialgesetzbuch (SGB V) regelt die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall sowie den Krankengeldanspruch. Eine Änderung in Richtung einer Teilkrankschreibung müsste hier verankert werden, um sicherzustellen, dass Arbeitnehmer in dieser Phase nicht finanziell benachteiligt werden.
Vorteile und Herausforderungen einer Teilkrankschreibung
Eine Teilkrankschreibung könnte sowohl für Arbeitnehmer als auch für Arbeitgeber Vorteile bringen, birgt aber auch Herausforderungen:
Potenzielle Vorteile:
- Arbeitnehmer könnten in ihrem individuellen Tempo in den Arbeitsprozess zurückkehren.
- Arbeitgeber hätten weniger Personalausfälle und könnten besser planen.
- Die psychische Belastung durch lange Fehlzeiten würde reduziert.
Mögliche Herausforderungen:
- Es besteht die Gefahr, dass Arbeitnehmer unter Druck gesetzt werden, zu früh wieder zu arbeiten.
- Arbeitgeber müssten neue organisatorische Lösungen finden.
- Die Abgrenzung zwischen krank und arbeitsfähig könnte komplizierter werden.
Mögliche Auswirkungen auf Arbeitnehmer
Eine Teilkrankschreibung könnte für Beschäftigte erhebliche Veränderungen mit sich bringen:
- Gehalt und Sozialleistungen: Je nach Regelung könnte sich das Einkommen verändern. Eine Mischung aus Teilgehalt und anteiligem Krankengeld wäre denkbar.
- Arbeitsbelastung: In Berufen mit hoher physischer oder psychischer Belastung könnte es schwer sein, eine Teilkrankschreibung sinnvoll umzusetzen.
- Psychologische Aspekte: Während manche Arbeitnehmer eine schrittweise Rückkehr als positiv empfinden, könnten andere sich durch den Druck belastet fühlen.
Mögliche Auswirkungen auf Arbeitgeber
Auch für Unternehmen hätte eine Teilkrankschreibung Konsequenzen:
- Flexibilität in der Personalplanung: Arbeitskräfte könnten trotz Erkrankung teilweise zur Verfügung stehen.
- Erhöhter Verwaltungsaufwand: Arbeitgeber müssten Arbeitszeiten und Lohnabrechnungen flexibel anpassen.
- Mitbestimmungsrechte: Betriebsräte könnten eine wichtige Rolle bei der Umsetzung spielen, insbesondere wenn es um den Schutz von Arbeitnehmern geht.
Fünf Fallbeispiele aus der Praxis
1. Rückenschmerzen und Homeoffice
Ein Büroangestellter mit Rückenproblemen arbeitet an drei Tagen pro Woche im Homeoffice. Rückenschmerzen sind eine der häufigsten Ursachen für Arbeitsunfähigkeit in Deutschland. Viele Büroangestellte leiden unter Problemen mit der Wirbelsäule, was die Arbeitsfähigkeit zwar einschränkt, aber nicht zwangsläufig eine vollständige Krankschreibung erfordert. Eine Teilkrankschreibung könnte in solchen Fällen helfen, eine längere Arbeitsunfähigkeit zu vermeiden, indem die Arbeitszeit reduziert oder ins Homeoffice verlegt wird.
Ein Büroangestellter, der an chronischen Rückenschmerzen leidet, erhält von seinem Arzt eine Krankschreibung. Vollständig arbeitsunfähig ist er jedoch nicht – mit einer ergonomischen Sitzlösung und regelmäßigen Pausen könnte er weiterhin einige Stunden am Tag arbeiten. Der Arbeitgeber ist skeptisch, da eine dauerhafte Heimarbeit nicht vorgesehen ist. Der Mitarbeiter bietet an, sich mit seinem Team über Aufgaben abzustimmen, die er auch von zu Hause aus erledigen kann.
Rechtlich betrachtet könnte eine Teilkrankschreibung in diesem Fall durch eine gesetzliche Anpassung möglich gemacht werden. Derzeit ist eine Krankschreibung nur als vollständige Arbeitsunfähigkeit ausgestaltet. Sollte das Gesetz geändert werden, müsste der Arbeitgeber entweder eine Lösung für Homeoffice oder eine angepasste Tätigkeit im Büro anbieten. Das Direktionsrecht des Arbeitgebers nach § 106 GewO erlaubt ihm, den Arbeitsort zu bestimmen, doch die Fürsorgepflicht erfordert auch Rücksichtnahme auf gesundheitliche Einschränkungen des Mitarbeiters.
FAQ 1: Kann mein Arbeitgeber mich trotz Teilkrankschreibung ins Büro zwingen?
Nein, wenn Homeoffice aus gesundheitlichen Gründen erforderlich ist und eine ärztliche Bescheinigung vorliegt, muss der Arbeitgeber eine Lösung finden.
FAQ 2: Muss ich meine vollen Aufgaben erfüllen, wenn ich teilkrankgeschrieben bin?
Nein, die Arbeitsbelastung wird an die reduzierte Arbeitsfähigkeit angepasst.
Zusammenfassend könnte eine Teilkrankschreibung Büroangestellten mit Rückenschmerzen helfen, weiterhin produktiv zu bleiben, ohne ihre Gesundheit zu gefährden. Arbeitgeber müssten Lösungen für eine flexible Arbeitsgestaltung finden.
2. Depression und stufenweise Rückkehr
Eine Arbeitnehmerin mit einer psychischen Erkrankung beginnt mit zwei Stunden täglicher Arbeit.
Psychische Erkrankungen sind oft schwer greifbar und dennoch eine der häufigsten Ursachen für längere Fehlzeiten. Viele Betroffene möchten nicht komplett aus dem Arbeitsleben ausscheiden, sind aber auch nicht in der Lage, ihre volle Arbeitsleistung zu erbringen. Eine Teilkrankschreibung könnte hier einen sanften Wiedereinstieg ermöglichen.
Eine Arbeitnehmerin leidet unter einer depressiven Episode und ist seit drei Wochen krankgeschrieben. Sie fühlt sich zunehmend isoliert und würde gerne zumindest einige Stunden täglich arbeiten, um sich wieder in den Alltag einzugliedern. Ihr Arbeitgeber hat jedoch Bedenken, ob sie dem Druck standhalten kann und ob ihre Produktivität ausreicht.
Das Betriebliche Eingliederungsmanagement (BEM) nach § 167 Abs. 2 SGB IX bietet bereits Möglichkeiten zur schrittweisen Wiedereingliederung. Eine gesetzliche Teilkrankschreibung könnte hier ergänzend wirken, indem sie bereits vor der kompletten Gesundung eine reduzierte Arbeitsaufnahme erlaubt. In diesem Fall müsste sichergestellt werden, dass der Druck auf den Arbeitnehmer nicht zu hoch wird und eine klare Absprache über die zumutbare Arbeitsbelastung erfolgt.
FAQ 1: Kann eine Teilkrankschreibung für psychische Erkrankungen genutzt werden?
Ja, wenn der Arzt feststellt, dass eine teilweise Arbeitsfähigkeit besteht, könnte eine Teilkrankschreibung sinnvoll sein.
FAQ 2: Muss ich Angst haben, dass mein Arbeitgeber mich unter Druck setzt, mehr zu arbeiten?
Nein, eine Teilkrankschreibung muss klar geregelt sein und darf nicht zur Überlastung führen.
Zusammenfassend könnte eine Teilkrankschreibung für psychische Erkrankungen den Übergang in den Arbeitsalltag erleichtern, wenn klare Rahmenbedingungen geschaffen werden. Arbeitgeber sollten mit Arbeitnehmern und Betriebsärzten individuelle Lösungen erarbeiten.
3. Pflegekräfte und Belastungsgrenzen
Eine Krankenschwester mit Knieproblemen reduziert vorübergehend ihre Stunden.
Pflegekräfte gehören zu den Berufsgruppen mit den höchsten körperlichen und psychischen Belastungen. Eine Teilkrankschreibung könnte hier helfen, die Arbeitsfähigkeit nach einer Erkrankung schrittweise wiederherzustellen, anstatt eine vollständige Krankschreibung fortzusetzen.
Eine Krankenschwester hat sich bei der Arbeit eine Knieverletzung zugezogen. Sie kann keine schweren Patienten heben oder lange stehen, möchte aber weiterhin leichtere Tätigkeiten wie Medikamentenvergabe oder administrative Arbeiten übernehmen. Ihr Arbeitgeber befürchtet jedoch, dass dies zu Unmut im Team führen könnte, da andere Mitarbeiter weiterhin voll belastet sind.
Nach § 164 Abs. 4 SGB IX sind Arbeitgeber verpflichtet, Arbeitnehmern mit gesundheitlichen Einschränkungen eine leidensgerechte Beschäftigung zu ermöglichen. Eine Teilkrankschreibung könnte hier eine sinnvolle Lösung sein, um die Krankenschwester weiter im Betrieb zu halten und ihr gleichzeitig die Möglichkeit zur Erholung zu geben. Wichtig wäre eine Absprache mit dem Betriebsrat, um eine faire Arbeitsverteilung zu gewährleisten.
FAQ 1: Können Pflegekräfte trotz Teilkrankschreibung für schwere Arbeiten eingeteilt werden?
Nein, eine Teilkrankschreibung muss die individuellen Einschränkungen berücksichtigen.
FAQ 2: Dürfen Kollegen sich beschweren, wenn jemand nur teilweise arbeitet?
Fairness ist wichtig, aber gesundheitliche Einschränkungen müssen respektiert werden. Eine gute Kommunikation im Team ist entscheidend.
Zusammenfassend könnte eine Teilkrankschreibung für Pflegekräfte eine flexible Rückkehr ermöglichen, wenn eine gerechte Arbeitsverteilung sichergestellt wird. Arbeitgeber müssen individuelle Lösungen finden, um Überlastung anderer Mitarbeiter zu vermeiden.
4. Industriearbeit mit körperlicher Belastung
Ein Produktionsmitarbeiter wechselt für einige Wochen in eine leichtere Tätigkeit.
In körperlich anspruchsvollen Berufen stellt sich die Frage, ob eine Teilkrankschreibung überhaupt praktikabel ist. Eine Lösung könnte sein, betroffene Mitarbeiter vorübergehend für weniger belastende Tätigkeiten einzusetzen.
Ein Produktionsmitarbeiter hat sich eine Sehnenentzündung im Arm zugezogen. Er kann keine schweren Lasten heben, könnte aber unterstützende Aufgaben übernehmen, wie Qualitätskontrollen oder Dokumentationen. Sein Arbeitgeber argumentiert jedoch, dass für solche Tätigkeiten keine separate Stelle existiert.
Das Arbeitsrecht verpflichtet Arbeitgeber, Gesundheitsrisiken zu minimieren. § 3 Abs. 1 Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) fordert, dass der Arbeitsplatz an die individuellen gesundheitlichen Bedingungen angepasst wird. Arbeitgeber sollten also prüfen, ob Alternativen möglich sind, anstatt eine vollständige Krankschreibung zu verlängern.
FAQ 1: Was passiert, wenn mein Arbeitgeber keine leichten Aufgaben für mich hat?
Dann könnte die Krankschreibung verlängert werden, oder es müssten Alternativen geprüft werden.
FAQ 2: Kann ich selbst entscheiden, welche Aufgaben ich übernehme?
Nein, dies muss gemeinsam mit dem Arbeitgeber und dem Arzt abgestimmt werden.
Zusammenfassend wäre eine Teilkrankschreibung in körperlichen Berufen nur praktikabel, wenn alternative Tätigkeiten vorhanden sind. Arbeitgeber sollten prüfen, ob durch Umstrukturierungen eine angepasste Beschäftigung möglich ist.
5. Arbeitgeberperspektive: Chancen und Herausforderungen
Für Arbeitgeber bietet eine Teilkrankschreibung sowohl Vorteile als auch Herausforderungen. Während sie helfen kann, wertvolle Arbeitskräfte zu erhalten, erfordert sie auch eine flexible Arbeitsorganisation.
Ein mittelständischer Unternehmer berichtet, dass in seinem Unternehmen häufig Mitarbeiter krankheitsbedingt ausfallen. Er sieht in der Teilkrankschreibung eine Möglichkeit, die Produktivität aufrechtzuerhalten. Gleichzeitig hat er Sorge, dass eine gesetzliche Verpflichtung ihn dazu zwingen könnte, nicht praktikable Lösungen zu finden.
Aus rechtlicher Sicht müsste eine Teilkrankschreibung durch klare gesetzliche Rahmenbedingungen geregelt werden. Eine Betriebsvereinbarung könnte helfen, den Umgang mit Teilkrankschreibungen individuell im Unternehmen festzulegen.
FAQ 1: Kann ein Unternehmen festlegen, dass Teilkrankschreibungen nicht akzeptiert werden?
Nein, wenn eine gesetzliche Regelung besteht, muss sie umgesetzt werden.
FAQ 2: Gibt es finanzielle Vorteile für Arbeitgeber durch Teilkrankschreibungen?
Ja, da sie möglicherweise die Kosten für Lohnfortzahlung und Krankengeld senken.
Zusammenfassend könnte eine Teilkrankschreibung für Unternehmen sinnvoll sein, wenn sie gut organisiert ist. Wichtig wäre eine enge Zusammenarbeit mit Betriebsräten und Arbeitnehmern, um praktikable Lösungen zu finden.
Fünf häufige Fragen zur Teilkrankschreibung
1. Kann der Arbeitgeber eine Teilkrankschreibung ablehnen?
Nein, wenn eine gesetzliche Regelung kommt, wäre die Teilkrankschreibung ein verbindliches Modell. Allerdings müssten Arbeitgeber der Umsetzung zustimmen, insbesondere wenn es um Homeoffice oder reduzierte Arbeitszeiten geht.
Eine der zentralen Fragen rund um das Thema Teilkrankschreibung ist, ob Arbeitgeber die Umsetzung verweigern könnten. Gerade in Unternehmen mit hoher Arbeitslast besteht die Sorge, dass eine reduzierte Arbeitsfähigkeit zu organisatorischen Problemen führt. Doch welche Rechte und Pflichten haben Arbeitgeber und Arbeitnehmer in diesem Kontext?
Zunächst muss geklärt werden, ob eine gesetzliche Grundlage für die Teilkrankschreibung existiert. Derzeit ist das nicht der Fall, aber in der Diskussion stehen Modelle, bei denen Arbeitnehmer auf Grundlage eines ärztlichen Attests weiterhin eingeschränkt arbeiten können. Arbeitgeber könnten die Teilkrankschreibung in Fällen ablehnen, in denen eine angepasste Tätigkeit objektiv nicht möglich ist – etwa bei schweren körperlichen Berufen ohne Alternativen. In anderen Fällen könnte jedoch eine Homeoffice-Regelung oder eine Reduzierung der Arbeitszeit praktikabel sein.
Rechtlich betrachtet hängt die Umsetzung von einer gesetzlichen Verankerung ab. Das Arbeitsrecht kennt bislang nur das Hamburger Modell, das eine schrittweise Wiedereingliederung nach längerer Krankheit erlaubt. Sollte eine gesetzliche Regelung eingeführt werden, wäre der Arbeitgeber grundsätzlich verpflichtet, die ärztlich bescheinigte Teilkrankschreibung zu akzeptieren – es sei denn, betriebliche Gründe sprechen nachweislich dagegen. In diesen Fällen müsste der Arbeitgeber Alternativen prüfen und eine Ablehnung nachvollziehbar begründen.
Fall 1: Ein IT-Administrator mit einer Handverletzung wird teilkrankgeschrieben und soll einfache Tätigkeiten im Homeoffice ausführen. Der Arbeitgeber verweist jedoch auf Datenschutzrichtlinien, die ein Arbeiten von zu Hause aus verbieten. Die Ablehnung könnte in diesem Fall zulässig sein.
Fall 2: Eine Erzieherin mit einer leichten Knieverletzung beantragt eine Teilkrankschreibung, um administrative Aufgaben in der Kita zu übernehmen. Der Arbeitgeber lehnt mit der Begründung ab, dass keine passenden Tätigkeiten vorhanden seien. In diesem Fall könnte eine gerichtliche Überprüfung notwendig werden.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Entscheidung über eine Teilkrankschreibung vom betrieblichen Umfeld abhängen würde. Arbeitgeber hätten unter Umständen ein Ablehnungsrecht, müssten jedoch Alternativen prüfen und nachweisen, dass eine Umsetzung nicht möglich ist. Arbeitnehmer sollten sich im Streitfall arbeitsrechtlich beraten lassen.
2. Welche finanziellen Folgen hat eine Teilkrankschreibung für Arbeitnehmer?
Je nach Modell könnte eine Kombination aus anteiligem Lohn und Krankengeld entstehen. Dies müsste gesetzlich genau geregelt werden.
Eine der größten Unsicherheiten bei einer möglichen Teilkrankschreibung ist die finanzielle Situation der Betroffenen. Viele Arbeitnehmer sorgen sich, dass sie im Falle einer reduzierten Arbeitszeit erhebliche Gehaltseinbußen hinnehmen müssten. Aber wie genau könnte sich eine Teilkrankschreibung auf das Einkommen auswirken?
Würde eine Teilkrankschreibung gesetzlich eingeführt, müsste eine Regelung zur finanziellen Absicherung getroffen werden. Denkbar wäre eine Kombination aus anteiligem Lohn und Krankengeld. Das bedeutet, dass Arbeitnehmer für die geleistete Arbeit Lohn erhalten, für die krankheitsbedingte Ausfallzeit jedoch anteilig Krankengeld von der Krankenkasse beziehen. Das Krankengeld beträgt derzeit 70 % des Bruttoverdienstes, maximal jedoch 90 % des Nettogehalts. In einer Teilkrankschreibung könnte eine Aufteilung in 50 % Arbeitszeit mit vollem Lohn und 50 % Krankengeld erfolgen.
Rechtlich müsste eine Anpassung des Entgeltfortzahlungsgesetzes (EFZG) und des Sozialgesetzbuchs (SGB V)erfolgen, um sicherzustellen, dass keine finanziellen Nachteile für Arbeitnehmer entstehen. Zudem könnte eine Regelung notwendig sein, die sicherstellt, dass Arbeitgeber nicht gezwungen werden, den vollen Lohn zu zahlen, obwohl eine reduzierte Arbeitsleistung erbracht wird.
Fall 1: Ein Vertriebsmitarbeiter arbeitet aufgrund einer Schulterverletzung nur noch 50 % seiner regulären Stunden. Er erhält für die geleistete Arbeitszeit volles Gehalt und für die übrigen Stunden Krankengeld. Sein Gesamteinkommen liegt bei etwa 85 % seines ursprünglichen Gehalts.
Fall 2: Eine Friseurin kann aufgrund einer Handverletzung nur noch Beratungsgespräche führen, aber keine Haare schneiden. Da der Arbeitgeber die Beratungstätigkeit nicht ausreichend entlohnen kann, erhält sie 60 % ihres ursprünglichen Gehalts und muss finanzielle Einbußen hinnehmen.
Zusammenfassend ist eine klare gesetzliche Regelung nötig, um finanzielle Nachteile für Arbeitnehmer zu vermeiden. In den meisten Fällen würde ein anteiliges Krankengeld-Modell Anwendung finden, das allerdings nicht immer das volle Einkommen sichert.
3. Gilt eine Teilkrankschreibung auch für schwere Erkrankungen?
Das hängt von der Art der Erkrankung ab. Bei Infektionskrankheiten oder schweren körperlichen Einschränkungen wäre eine vollständige Krankschreibung weiterhin notwendig.
Eine wesentliche Frage ist, ob eine Teilkrankschreibung auch bei schwereren Erkrankungen möglich wäre oder ob sie sich auf leichtere Fälle wie Erkältungen oder Rückenprobleme beschränken würde.
Bei schweren Erkrankungen könnte eine Teilkrankschreibung nur dann sinnvoll sein, wenn der Patient trotz gesundheitlicher Einschränkungen noch eingeschränkt arbeitsfähig ist. Hier könnte die ärztliche Einschätzung entscheidend sein. Beispielsweise könnte eine Krebspatientin, die sich einer Chemotherapie unterzieht, an einigen Tagen arbeitsfähig sein, an anderen jedoch nicht.
Nach aktuellem Stand des Arbeitsrechts ist eine Krankschreibung entweder vollständig oder gar nicht gegeben. Würde eine Teilkrankschreibung eingeführt, müsste klar definiert werden, welche Erkrankungen darunterfallen und ob bestimmte Gruppen – z. B. Personen mit schweren chronischen Erkrankungen – besondere Regelungen benötigen.
Fall 1: Ein Lehrer mit Multipler Sklerose hat an manchen Tagen starke Einschränkungen, kann jedoch an anderen Tagen unterrichten. Eine Teilkrankschreibung würde ihm ermöglichen, flexibel zu arbeiten.
Fall 2: Ein Bauarbeiter mit einem Bandscheibenvorfall kann keine körperlich schweren Tätigkeiten ausführen, aber Dokumentationsaufgaben übernehmen. Sein Arbeitgeber gewährt ihm eine Teilkrankschreibung, um eine frühere Rückkehr zu ermöglichen.
Zusammenfassend wäre eine Teilkrankschreibung in vielen Fällen denkbar, jedoch müsste klar geregelt werden, welche Krankheitsbilder darunterfallen und wie eine faire Umsetzung erfolgen kann.
4. Welche Rolle spielt der Betriebsrat bei der Einführung einer Teilkrankschreibung?
Betriebsräte könnten darauf achten, dass Arbeitnehmer nicht unter Druck gesetzt werden und dass eine gerechte Umsetzung erfolgt.
Da eine Teilkrankschreibung sowohl Arbeitnehmer- als auch Arbeitgeberinteressen berührt, wäre der Betriebsrat ein zentraler Akteur bei der Umsetzung.
Der Betriebsrat hat nach § 87 Abs. 1 BetrVG ein Mitbestimmungsrecht bei Fragen der Arbeitszeitgestaltung und Gesundheitsmaßnahmen. Er könnte also darauf hinwirken, dass Teilkrankschreibungen nicht missbraucht werden und Arbeitnehmer nicht unter Druck gesetzt werden, trotz Krankheit zu arbeiten.
Fall 1: Ein Betriebsrat setzt durch, dass Teilkrankschreibungen erst nach ärztlicher Empfehlung erfolgen dürfen, um Missbrauch durch Arbeitgeber zu verhindern.
Fall 2: Ein Unternehmen plant, Teilkrankschreibungen grundsätzlich nicht zu akzeptieren. Der Betriebsrat klagt auf Mitbestimmung und erreicht eine Einzelfallprüfung.
Zusammenfassend könnte der Betriebsrat eine wichtige Schutzfunktion übernehmen und sicherstellen, dass Teilkrankschreibungen fair und arbeitnehmerfreundlich gestaltet werden.
5. Wie unterscheidet sich die Teilkrankschreibung vom Hamburger Modell?
Das Hamburger Modell ist eine Wiedereingliederung nach längerer Krankheit mit schrittweiser Steigerung der Arbeitszeit, während eine Teilkrankschreibung bereits in einer früheren Krankheitsphase greifen könnte.
Ein mittelständischer Unternehmer berichtet über Herausforderungen und Chancen einer Teilkrankschreibung.
Das Hamburger Modell ist ein etabliertes Konzept zur stufenweisen Wiedereingliederung nach langer Krankheit, während die Teilkrankschreibung eine frühere Rückkehr ermöglichen würde.
Während das Hamburger Modell nur nach sechs Wochen Krankschreibung greift, könnte eine Teilkrankschreibung bereits früher ansetzen. Zudem ist das Hamburger Modell eine freiwillige Maßnahme, während eine Teilkrankschreibung verbindlich geregelt werden müsste.
Fall 1: Eine Lehrerin kehrt nach sechs Monaten Krankheit im Rahmen des Hamburger Modells mit wenigen Stunden pro Woche zurück.
Fall 2: Ein Büromitarbeiter mit einer Erkältung arbeitet im Rahmen einer Teilkrankschreibung halbtags.
Zusammenfassend wäre eine Teilkrankschreibung flexibler als das Hamburger Modell und würde eine frühere Rückkehr ermöglichen, müsste aber rechtlich sauber geregelt werden.
Fazit zum Thema Teilkrankschreibung:
Die Einführung einer Teilkrankschreibung könnte eine sinnvolle Ergänzung zum bestehenden System sein, wenn sie sorgfältig reguliert wird. Wichtig ist, dass sie nicht als Druckmittel für Arbeitnehmer missbraucht wird, sondern wirklich der gesundheitlichen und beruflichen Wiedereingliederung dient. Unternehmen und Beschäftigte sollten sich daher frühzeitig mit den möglichen Veränderungen auseinandersetzen.
Die genaue Umsetzung bleibt abzuwarten – bis dahin sollten Sie sich bei arbeitsrechtlichen Fragen stets professionell beraten lassen.
Sie benötigen weiteren rechtlichen Rat?
Nutzen Sie unsere Online-Anfrage für einen schnellen Check.
Die Schilderung Ihres Problems und eine kurze Ersteinschätzung sind kostenlos, wenn Sie gekündigt wurden oder einen Aufhebungsvertrag erhalten haben.
Für alle anderen Anliegen können Sie gerne eine kostenpflichtige Erstberatung in Anspruch nehmen.