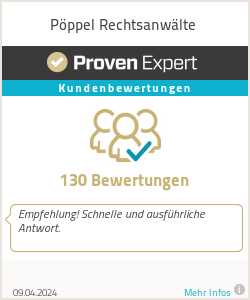In Deutschland gibt es keinen generellen gesetzlichen Anspruch auf unbezahlten Urlaub. Eine Freistellung ohne Lohnzahlung ist nur in Ausnahmefällen oder durch Vereinbarung möglich. Bekannte Gründe sind etwa die Betreuung eines kranken Kindes, Pflege eines Angehörigen, Elternzeit oder längere Weiterbildung. Arbeitgeber und Arbeitnehmer müssen sich hier einig sein oder es muss eine Rechtsgrundlage bestehen. Dabei ist wichtig: Unbezahlter Urlaub bedeutet in der Regel, dass keine Vergütung gezahlt wird und Sozialversicherungsbeiträge nur für den ersten Monat weiterlaufen.
Kurz und Knapp
- Kein genereller Anspruch. Üblicherweise entscheidet der Arbeitgeber nach Ermessen. Nur bei besonderen gesetzlichen Ausnahmen (z.B. Kinder- oder Pflegezeit) besteht ein gesetzliches Recht.
- Mögliche Ausnahmen: Kurzfristige Pflege naher Angehöriger (bis 10 Tage) oder längere Pflege (bis 6 Monate) nach Pflegezeitgesetz, Kinderkrankentage (§ 45 SGB V), Elternzeit (bis zu 3 Jahre), sowie wichtige familiäre oder persönliche Gründe.
- Vertragliche Regelungen: Tarifverträge, Arbeitsverträge oder Betriebsvereinbarungen können unbezahlten Urlaub vorsehen. Auch eine mehrfache freiwillige Gewährung kann als betriebliche Übung wirksam sein.
- Antrag und Vereinbarung: Am besten schriftlich. Eine klare Vereinbarung schützt beide Seiten. Ohne Regelung muss der Arbeitgeber zustimmen. Betriebsräte können bei der Ausgestaltung helfen.
- Rechte und Folgen: Während unbezahltem Urlaub endet nach einem Monat der Sozialversicherungsschutz – der oder die Beschäftigte muss sich selbst krankenversichern. Für die Dauer des Urlaubs entstehen keine Urlaubsansprüche. Viele unterschätzen dies oft als Fallstrick.
Wann besteht ein Anspruch auf unbezahlten Urlaub?
Ein gesetzlicher Anspruch auf unbezahlten Urlaub besteht grundsätzlich nicht. Das heißt: Die vertragliche Arbeitsleistungspflicht besteht weiterhin, und der Arbeitgeber muss in der Regel keinen unbezahlten Urlaub gewähren. Eine solche Freistellung liegt weitgehend im Ermessen des Arbeitgebers. Nur in seltenen Ausnahmefällen kann ein Anspruch auf unbezahlte Freistellung bestehen: etwa dann, wenn aus Fürsorgegründen eine Notlage vorliegt (z.B. plötzliches Erkranken eines nahen Angehörigen) oder wenn eine gesetzliche Regelung dies vorsieht. Ist nichts im Arbeits- oder Tarifvertrag geregelt, kann nur im gegenseitigen Einvernehmen unbezahlter Urlaub vereinbart werden.
Folgende Punkte sind hier wichtig:
- Keine allgemeine Freistellungspflicht: Arbeitnehmer können nach dem Grundsatz der Leistungserbringung ihren Urlaub grundsätzlich nicht einseitig durchsetzen.
- Vertragliche Grundlagen: Bestehen im Arbeitsvertrag oder Tarifvertrag Regelungen für unbezahlten Urlaub (z.B. Sabbatical-Modelle), hat der Arbeitnehmer ggf. darauf einen Anspruch. Ohne solche Regelungen bleibt der Arbeitgeber frei, Ersuchen abzulehnen.
- Betriebliche Übung: Hat der Arbeitgeber in der Vergangenheit mehrfach unbezahlten Urlaub bewilligt (etwa dreimal oder öfter bei vergleichbarer Sachlage), kann eine betriebliche Übung eintreten. Dann könnte sich bei gleicher Situation ein Anspruch für weitere Mitarbeitende ergeben.
In welchen Fällen gibt es gesetzlich geregelte Freistellungen?
Es gibt mehrere gesetzliche Tatbestände, die (unbezahlte) Freistellungen vorsehen – meistens in Notsituationen oder besonderen Lebensphasen. Wichtige Beispiele sind:
- Pflege von Angehörigen (§ 2 und § 3 PflegeZG): Bei akut auftretendem Pflegebedarf kann man bis zu 10 Arbeitstage von der Arbeit fernbleiben (kurzzeitige Arbeitsverhinderung). Voraussetzung ist, dass ein naher Angehöriger plötzlich pflegebedürftig wird und sofort organisiert werden muss, wie etwa nach einem Unfall oder Krankenhausaufenthalt. Für länger andauernde Pflege (Pflegezeit) haben Arbeitnehmer:innen in Betrieben mit mindestens 15 Beschäftigten einen Anspruch auf bis zu sechs Monate unbezahlte Freistellung (§ 3 PflegeZG). (In Kleinbetrieben kann der Arbeitgeber hier ablehnen.)
- Betreuung kranker Kinder (§ 45 SGB V – „Kinderkrankentage“): Für gesetzlich Krankenversicherte besteht ein Anspruch auf unbezahlte Freistellung, wenn ein eigenes Kind unter 12 Jahren krank ist und gepflegt werden muss. Pro Elternteil (bei Eheleuten bzw. Lebenspartnern) sind je nach Kinderzahl jährlich bis zu etwa 35 Tagemöglich; Alleinerziehende haben das Doppelte. (Voraussetzung ist Anspruch auf Krankengeld; während dieser Zeit zahlt der Arbeitgeber kein Gehalt.)
- Elternzeit (BEEG § 15): Geburt und Erziehung eines Kindes begründen einen gesetzlichen unbezahlten Anspruch. Eltern können für die Betreuung bis zu 36 Monate Elternzeit nehmen. In dieser Zeit ruht das Arbeitsverhältnis ohne Vergütungsanspruch. Nach Ablauf der Elternzeit besteht das Arbeitsverhältnis fort, ohne dass es neuerlich vereinbart werden muss.
- Bildungsurlaub und Weiterbildung: In manchen Bundesländern ist ein bezahlter Bildungsurlaub gesetzlich geregelt; unabhängig davon können Arbeitnehmer mit dem Arbeitgeber auch eine unbezahlte Freistellung zur Weiterbildung vereinbaren. Ein Anspruch darauf besteht jedoch nur, wenn es tarifvertraglich oder einzelvertraglich geregelt ist. Viele Unternehmen bieten (ggf. in Absprache mit dem Betriebsrat) Sabbatical-Regelungen an, um längere Bildungs- oder Auszeiten zu ermöglichen.
- Ehrenamt, Wahlämter und Studium: Tarifverträge oder Betriebsvereinbarungen enthalten manchmal Sonderregelungen für Ehrenämter (z.B. Feuerwehr, THW, kommunale Mandate) oder „wichtige Gründe“ wie ein nebenberufliches Studium oder die Begleitung eines im Ausland tätigen Ehepartners. Dabei kann eine unbezahlte Freistellung (häufig auch bezahlt) vorgesehen sein, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Ein Beispiel: § 616 BGB gewährt bei persönlicher Verhinderung (z.B. eigene Hochzeit, Gerichtstermin, schwere Familienunglücke) normalerweise bezahlten Urlaub, sofern der Vertrag dies nicht ausschließt. Viele verwechseln das mit unbezahltem Urlaub, doch § 616 BGB betrifft immer bezahlte Sonderfälle.
Welche Rolle spielen Arbeitsvertrag, Tarifvertrag und Betriebsvereinbarung?
Vertragliche Regelungen können entscheidend sein: Ein Arbeitsvertrag kann einen Anspruch auf unbezahlten Urlaub definieren (z.B. nach mehrjähriger Betriebszugehörigkeit ein Sabbatjahr). Auch Tarifverträge enthalten oft Freistellungsrechte (bezahlter oder unbezahlter Sonderurlaub) für bestimmte Anlässe oder Personengruppen. Ebenso kann eine Betriebsvereinbarung (ggf. in Abstimmung mit dem Betriebsrat) unbezahlten Urlaub festschreiben oder erleichtern (etwa über Arbeitszeitkonten oder Sabbatical-Modelle).
Praktisch gilt: Fehlt eine solche Regelung, müssen Arbeitgeber und Beschäftigte den unbezahlten Urlaub jeweils vereinbaren. Der Betriebsrat kann hierbei mitbestimmen (§ 87 Abs. 1 BetrVG) oder Initiative ergreifen, z.B. durch Vorschläge für Betriebsvereinbarungen zum Langzeiturlaub. Hat der Arbeitgeber in Einzelfällen bereits unbezahlte Urlaubstage gewährt, kann daraus bei Wiederholung ein Anspruch durch betriebliche Übung entstehen.
Besonderheit Kleinbetriebe
Einige Ansprüche (wie die 6-monatige Pflegezeit) gelten nur bei mindestens 15 Mitarbeitern. In Betrieben mit weniger Beschäftigten besteht kein gesetzlicher Freistellungsanspruch für lange Pflegezeiten. Arbeitnehmer in kleinen Betrieben sollten daher frühzeitig das Gespräch mit dem Chef suchen oder ihren Betriebsrat um Unterstützung bitten. Betriebsräte in kleinen Firmen können auf Kulanzregelungen drängen oder Hilfestellung bei Verhandlungen geben.
Wie vereinbart man unbezahlten Urlaub und was ist zu beachten?
Da kein Standardverfahren existiert, hilft eine klare Absprache: Stellen Sie einen schriftlichen Antrag auf unbezahlten Urlaub – darin sollten Dauer und Anlass genannt und idealerweise von beiden Seiten unterschrieben werden. So ist der Zeitraum verbindlich festgehalten. Auch per E‑Mail (mit Lesebestätigung) kann eine Vereinbarung zustande kommen, doch ein unterschriebener Vertrag oder eine schriftliche Bestätigung ist sicherer.
Wichtige Hinweise:
- Antragsinhalte: Geben Sie den gewünschten Zeitraum und den Grund an (z.B. Pflegefall, Weiterbildung, Elternzeit). Bleiben Sie sachlich, aber deutlich.
- Abstimmung mit dem Arbeitgeber: Da es keinen Rechtsanspruch gibt, muss der Arbeitgeber zustimmen. Gehen Sie auf mögliche betriebliche Belange ein (z.B. Urlaubsvertretung, Projektplanung).
- Betriebsrat informieren: In Firmen mit Betriebsrat kann dieser den Prozess begleiten. Oftmals können Betriebsräte praktische Tipps geben (z.B. zu üblichen Laufzeiten von Sabbaticals) und auf etwaige tarifliche Regeln hinweisen.
- Kündigungsschutz während der Freistellung: Das Arbeitsverhältnis ruht, bleibt aber bestehen. Während des unbezahlten Urlaubs besteht grundsätzlich Kündigungsschutz nach den üblichen Regeln (z.B. Schutz des Kündigungsschutzgesetzes, Schwangeren- und Elternschutz). Dennoch kann das Arbeitsverhältnis zum üblichen Termin gekündigt werden – eine Kündigung beendet das Freistellungsverhältnis aber nicht automatisch, ggf. muss Arbeit unter Fortzahlung von Lohn wiederaufgenommen werden.
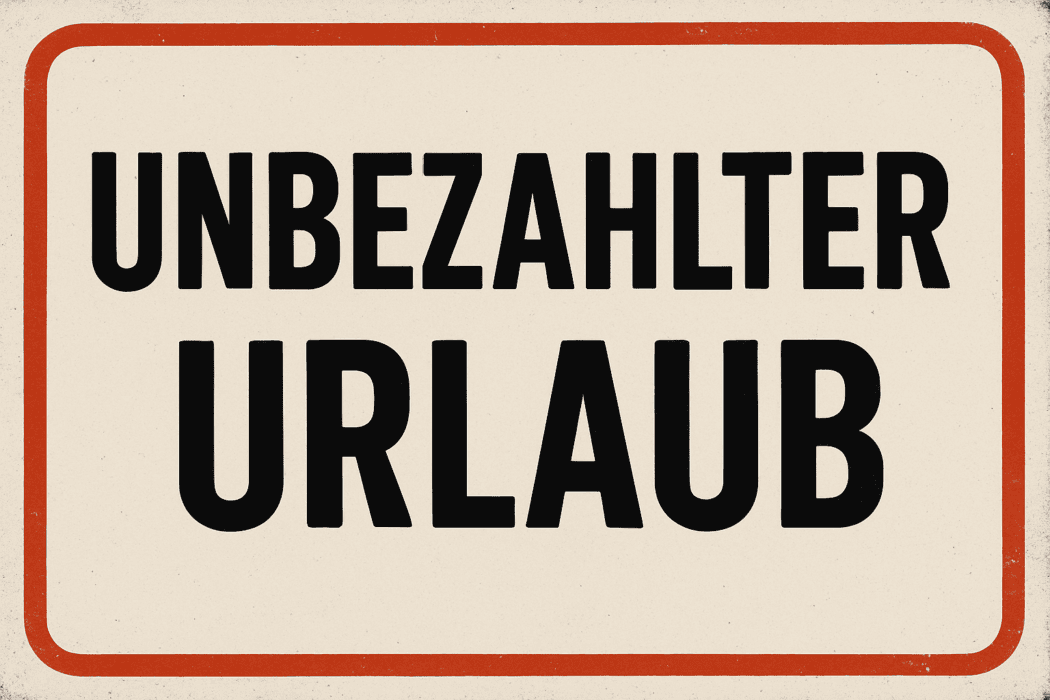
Wie lange kann unbezahlter Urlaub dauern – und kann er vorzeitig beendet werden?
Es gibt keine gesetzlich festgelegte Höchstdauer für unbezahlten Urlaub. Im Prinzip einigen sich Arbeitnehmer und Arbeitgeber auf eine konkrete Dauer – die je nach Anlass wenige Tage, Wochen oder mehrere Monate betragen kann. Ist jedoch ein gesetzliches Recht im Spiel, gelten dort Grenzen: Bei der Kinderbetreuung (§45 SGB V) ist z.B. die Zahl der Tage pro Jahr begrenzt. Bei der Pflegezeit (§3 PflegeZG) sind es maximal 6 Monate pro Angehörigem. Bei der Elternzeit ist die Befristung auf drei Jahre per Gesetz verankert.
Sind die Rahmenbedingungen geklärt, kann unbezahlter Urlaub auf Wunsch vorzeitig beendet werden, wenn beide Seiten zustimmen. Ausnahmen: Kinderkranktage (§45 SGB V) und Pflegefreistellungen können meist spontan abgekürzt werden, sobald sich die Situation ändert (z.B. wenn das Kind wieder gesund ist oder eine Pflegekraft einspringt) – eine Rückkehr an den Arbeitsplatz kann dann auch einseitig durch den Arbeitnehmer erfolgen. Wenn im Arbeits- oder Tarifvertrag ein einseitiges Beendigungsrecht verankert ist, ist dies ebenfalls zu beachten.
Welche Auswirkungen hat unbezahlter Urlaub auf Sozialversicherung und Urlaubstage?
Unbezahlter Urlaub bringt einige rechtliche Folgen mit sich:
- Lohnzahlung: Während des unbezahlten Urlaubs entfällt die Lohnzahlung. Der Arbeitgeber ist nicht mehr verpflichtet, Entgelt zu zahlen, und der Arbeitnehmer muss keine Arbeitsleistung erbringen. Nebenpflichten wie Konkurrenzverbot oder Verschwiegenheit bleiben bestehen.
- Sozialversicherung: Entscheidend ist die Dauer des unbezahlten Urlaubs. Dauert er nicht länger als einen Monat, bleibt die Versicherungspflicht (Kranken-, Pflege-, Renten- und Arbeitslosenversicherung) bestehen. Der Arbeitgeber zahlt weiter Abgaben – der Arbeitnehmer bleibt über den Arbeitgeber gesetzlich krankenversichert. Bei längerem Urlaub (ab dem 2. Monat) endet die Versicherungspflicht aus dem Beschäftigungsverhältnis. Dann muss der Arbeitgeber den Beschäftigten abmelden. Für die Zeit danach müssen sich Arbeitnehmer selbst um Krankenversicherung kümmern (z.B. freiwillig gesetzlich oder privat versichern). Bei Wiederaufnahme der Arbeit meldet der Arbeitgeber den Beschäftigten wieder an.
- Urlaubsanspruch: Da kein Arbeitsentgelt gezahlt wird, rechnet diese Zeit nicht als Arbeitstage nach dem Bundesurlaubsgesetz. Das Bundesarbeitsgericht hat klargestellt, dass für die Dauer eines unbezahlten Urlaubs kein Anspruch auf Urlaub (Erholungsurlaub) erwächst. Anders ausgedrückt: Die regulären Urlaubsansprüche können anteilig gekürzt werden, wenn Arbeitnehmer länger unbezahlten Urlaub nehmen. (Früher gingen manche Gerichte anders aus, aber die aktuelle Rechtsprechung bestätigt, dass unbezahlte Freistellung wie eine völlig „arbeitsfreie Zeit“ zu behandeln ist.)
- Krankenkasse: Wenn kein Einkommen mehr fließt, treten nach einem Monat besondere Regeln in Kraft – etwa die Anschlussversicherung bei der Krankenkasse. Arbeitnehmer sollten rechtzeitig mit ihrer Krankenkasse sprechen, um Versicherungslücken zu vermeiden.
- Rentenversicherung: Da Rentenbeiträge anteilig zur Vergütung gezahlt werden, können sich in der unbezahlten Zeit Lücken in den Rentenansprüchen ergeben. Unter bestimmten Bedingungen kann man freiwillig weitermelden lassen.
- Steuerliche Behandlung: Da kein Lohn zufließt, entfallen auch Lohnsteuer- und Sozialversicherungsbeiträge. Eventuelle geldwerte Vorteile (z.B. Firmenwagen) müssen trotzdem weiterhin versteuert werden.
- Arbeitslosengeld/ALG I: Die Zeit der unbezahlten Freistellung kann sich bei Bezug von ALG I als Sperrzeit auswirken, wenn Arbeitnehmer selbst auf Urlaub drängen. Es ist ratsam, dies vorab mit der Agentur für Arbeit abzuklären.
Praktischer Tipp: Lassen Sie sich bestätigen, dass Sie während des unbezahlten Urlaubs weiterhin als sozialversicherungspflichtig gelten. Arbeitgeber können eine Unterbrechungsmeldung zur Krankenkasse abgeben, damit der Versicherungsschutz formal erhalten bleibt, wenn Sie zum Monatsende aus dem Urlaub zurückkehren. Andernfalls gilt: Am Ende des ersten Urlaubsmonats sollten Sie aus der GKV abgemeldet werden und sich rechtzeitig um eine Anschlusslösung kümmern.
Tipps, Risiken und Irrtümer rund um unbezahlten Urlaub
- Irrtum „§ 616 BGB gewährt Urlaub“: Viele glauben, in Notfällen stehe automatisch bezahlter Urlaub zu. § 616 BGB kann in Notsituationen (z.B. Trauerfall, Gerichtstermin) eine bezahlte Freistellung ermöglichen – aber nur, wenn der Arbeitsvertrag das nicht ausschließt. Ansonsten ist diese Zeit eben unbezahlt.
- Urlaubsanspruch stimmt nicht: Unbezahlter Urlaub ist keine Ergänzung zum Jahresurlaub. Nach aktueller Rechtsprechung entsteht für diese Zeit keinerlei Erholungsurlaub. Viele denken, sie bekämen später mehr Urlaubstage, das stimmt aber nicht.
- Sozialversicherung vernachlässigt: Wurde oft übersehen: Ab dem zweiten Monat ist eigene Krankenversicherung Pflicht. Anderenfalls verliert man unbemerkt den Schutz. Klären Sie Versicherungsfragen frühzeitig!
- Wechselwirkungen mit anderen Freistellungen: Elternzeit, Mutterschutz oder Pflegezeit gelten gesondert und stehen zusätzlich zum regulären Urlaub. Aufrechnung oder Abzug laufen nach eigenen Regeln.
- Kündigung in der Auszeit: Das Arbeitsverhältnis besteht fort. Im unbezahlten Urlaub gilt der normale Kündigungsschutz. Eine Kündigung wirkt also auch im Urlaub; der Urlaub selbst verhindert keine Kündigung. Arbeitnehmer sollten sich dessen bewusst sein und ihre Kündigungsfristen prüfen.
- Arbeitgeber-Sicht: Arbeitgeber können bei Ablehnung eines Urlaubsantrags oft betriebliche Gründe anführen (z.B. Personalmangel, wichtiges Projekt). Eine pauschale «Schuld» liegt nicht vor. Aus Sicht des Arbeitgebers ist außerdem wichtig, die Vereinbarung schriftlich festzuhalten, um Unklarheiten zu vermeiden.
Was können Arbeitnehmer und Betriebsräte tun?
Pragmatisch gilt: Kommunikation ist entscheidend. Arbeitnehmer:innen sollten konkrete Anträge stellen und gegebenenfalls mit Unterlagen belegen (z.B. Pflegebescheinigung, Ausbildungsnachweis). Der Betriebsrat kann fragen, ob nicht Lösungen wie flexible Arbeitszeitkonten oder Teilzeitmodelle anstelle von vollständiger Freistellung möglich sind. In größeren Unternehmen gibt es oft auch Anträge auf Lebensarbeitszeitkonten oder Sabbaticals – Betriebsräte können diese Modelle vorstellen oder verhandeln.
Für Betriebsräte ist es wichtig, sowohl rechtliche Lücken als auch individuelle Bedürfnisse zu kennen: Sie können kollektive Vereinbarungen (Sabbatical-Regelungen, Pflegevereinbarungen) anregen und darauf achten, dass das Verfahren transparent ist. Es lohnt sich auch, über betriebliche Übung zu sprechen: Haben Kolleg:innen mehrmals unbezahlten Urlaub bewilligt bekommen, kann man darauf hinweisen, dass ein Anspruch droht. Bei Konflikten kann es ratsam sein, juristische Beratung hinzuzuziehen oder Mediationsangebote der Gewerkschaft zu nutzen.
Fazit: Ein Anspruch auf unbezahlten Urlaub muss oft verhandelt werden. Sind die Voraussetzungen (gesetzlich oder vertraglich) erfüllt, muss der Arbeitgeber die Freistellung zumeist gewähren. Fehlen diese, hilft nur Verhandlungsgeschick – unterstützt durch klare Argumente, Betriebsrat und ggf. Rechtsberatung. Unabdingbar ist, die Konsequenzen (Sozialversicherung, Urlaub) im Blick zu behalten.
Hilfe durch Pöppel Rechtsanwälte
Bei Unklarheiten und Unsicherheiten zum Thema „unbezahlter Urlaub“ unterstützt Sie gern die Kanzlei Pöppel Rechtsanwälte. Unsere Fachanwälte für Arbeitsrecht prüfen Ihre individuelle Situation – bundesweit und unverbindlich. Kontaktieren Sie uns für eine kompetente Beratung.
Sie benötigen weiteren rechtlichen Rat?
Nutzen Sie unsere Online-Anfrage für einen schnellen Check.
Die Schilderung Ihres Problems und eine kurze Ersteinschätzung sind kostenlos, wenn Sie gekündigt wurden oder einen Aufhebungsvertrag erhalten haben.
Für alle anderen Anliegen können Sie gerne eine kostenpflichtige Erstberatung in Anspruch nehmen.